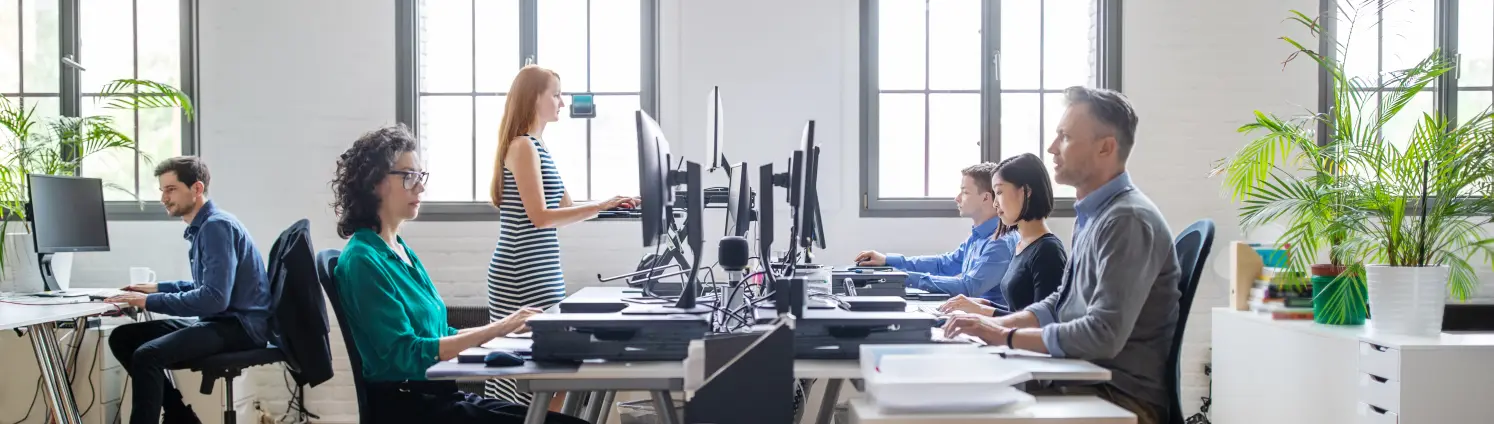
Fragen und Antworten.
Sie haben noch Fragen? Wir helfen Ihnen gern.
In unseren FAQ finden Sie hilfreiche Informationen und Antworten auf häufig gestellte Fragen. Wir klären unklare Begriffe in Ihren Rechnungen, erläutern verschiedene elektronische Rechnungsformate und gehen auf wichtige Themen wie dem CO2-Preis und dem CO2-Kostenaufteilungsgesetz ein.
FAQ zur Allgemeinen Rechnungslegung
Begriffe und Definitionen Ihrer Stromrechnung
Quelle
Leitfaden Kundenrechnung Strom unter Berücksichtigung der EnWG Novelle 2011, Herausgegeben vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW), Berlin sowie vom Verband kommunaler Unternehmen e. V. (VKU), Berlin, Dezember 2013.
Abschlag
Der Abschlag ist eine Teilzahlung bzw. Anzahlung auf die bereits geleisteten Energielieferungen; Die Höhe des Abschlages orientiert sich an dem zu erwartenden Energieverbrauch und kann sich mit jeder Abrechnung anpassen.
Blindarbeit
Die Blindarbeit ist der Anteil der elektrischen Energie, der nicht in Nutzenergie umgewandelt wird, sondern beim Aufbau elektromagnetischer und elektrischer Felder verbraucht wird. Die Blindarbeit wird in kvarh angegeben. Überschreitet die Blindarbeit eine bestimmte Grenze, kann sie zusätzlich in Rechnung gestellt werden.
EEG-Umlage
Die EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz)-Umlage fördert die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien. Die daraus entstehenden Mehrbelastungen werden bundesweit auf die Letztverbraucher umgelegt und jährlich neu berechnet und veröffentlicht.
Grundpreis
Kosten, die unabhängig vom Energieverbrauch entstehen.
Identifikationsnummer der Marktlokation MaLo - ID
Die Identifikationsnummer der Marktlokation (MaLo-ID) dient der eindeutigen Identifizierung einer Verbrauchsstelle, Wohnung oder Einspeisestelle.
Identifikationsnummer der Messlokation (Zählpunktbezeichnung)
Die Identifikationsnummer der Messlokation (Zählpunktbezeichnung) dient der eindeutigen Identifizierung der Messeinrichtung.
Konzessionsabgabe
Die Konzessionsabgabe ist ein Entgelt an die Kommune für die Mitbenutzung von öffentlichen Verkehrswegen durch Versorgungsleitungen.
KWK-Umlage
Die KWK-Umlage fördert die ressourcenschonende gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme. Die aus dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) entstehenden Belastungen werden bundesweit auf die Letztverbraucher umgelegt, regelmäßig angepasst und veröffentlicht.
Leistungspreis
Für die in Anspruch genommene Leistung in Kilowatt (kW) wird je nach Vereinbarung ein Leistungspreis in Rechnung gestellt. Dieser richtet sich nach den Leistungsentgelten des jeweiligen Netzbetreibers.
Messstellenbetrieb
Der Messstellenbetrieb umfasst die Bereitstellung sowie Betrieb und Wartung von Zählern.
Messdienstleistung (Messung)
Die Messdienstleistung beinhaltet die Ermittlung des Energieverbrauchs sowie die Erfassung, Verwaltung und Bereitstellung der Zählerdaten durch den Messdienstleister.
Netzbetreibernummer
Die Netzbetreibernummer dient der eindeutigen Identifikation des örtlichen Verteilnetzbetreibers, an dessen Netz die Lieferstelle angeschlossen ist.
Netzentgelte
Die Netzentgelte sind Entgelte für den Transport und die Verteilung der Energie sowie die damit verbundenen Dienstleistungen; bestimmte staatliche Abgaben werden mit den Netzentgelten erhoben.
Offshore-Haftungsumlage
Die Offshore-Haftungsumlage sichert Risiken der Anbindung von Offshore-Windparks an das Stromnetz ab; Die daraus entstehenden Belastungen werden bundesweit auf die Letztverbraucher umgelegt.
Stromkennzeichnung
Die Stromkennzeichnung informiert über die Herkunft des bezogenen Stroms (Energiemix) und dessen Umweltauswirkungen; Sie ist gesetzlich vorgeschrieben.
Stromsteuer
Die Stromsteuer ist eine durch das Stromsteuergesetz geregelte Steuer auf den Energieverbrauch.
Umlage abschaltbare Lasten
Die Umlage für abschaltbare Lasten dient auf der Grundlage des § 13 Abs. 4a und 4b EnWG der Versorgungssicherheit durch die Förderung abschaltbarer Verbrauchseinrichtungen.
Verbrauch (kWh)
Der Verbrauch ist die in Anspruch genommene Arbeit und wird in Kilowattstunden (kWh) ausgewiesen.
Verbrauchspreis oder Arbeitspreis
Der Verbrauchs-/Arbeitspreis bezeichnet den Preis für eine in Anspruch genommene Kilowattstunde Energie. § 19 StromNEV-Umlage: Die §19 StromNEV-Umlage finanziert die Entlastung bzw. Befreiung stromintensiver Unternehmen von Netzentgelten. Die aus der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) entstehenden Belastungen werden bundesweit auf die Letztverbraucher umgelegt.
Begriffe und Definitionen Ihrer Gasrechnung
Quelle
Leitfaden Kundenrechnung Gas unter Berücksichtigung der EnWG Novelle 2011, Herausgegeben vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW), Berlin sowie vom Verband kommunaler Unternehmen e. V. (VKU), Berlin, Aktualisierte Fassung , November 2017.
Abschlag
Der Abschlag ist eine Teilzahlung bzw. Anzahlung auf die bereits geleisteten Energielieferungen; Die Höhe des Abschlages orientiert sich an dem zu erwartenden Energieverbrauch und kann sich mit jeder Abrechnung anpassen.
Brennwert
Der Brennwert zeigt an, wie viel Energie im Gas auf Grund der chemischen Zusammensetzung enthalten ist.
Grundpreis
Kosten, die unabhängig vom Energieverbrauch entstehen.
Konzessionsabgabe
Die Konzessionsabgabe ist ein Entgelt an die Kommune für die Mitbenutzung von öffentlichen Verkehrswegen durch Versorgungsleitungen.
Leistungspreis
Für die in Anspruch genommene Leistung in Kilowatt (kW) wird je nach Vereinbarung ein Leistungspreis in Rechnung gestellt. Dieser richtet sich nach den Leistungsentgelten des jeweiligen Netzbetreibers.
Lieferstelle
Die Lieferstelle ist der Ort, an dem die Energielieferung erbracht wird.
Identifikationsnummer der Marktlokation MaLo - ID
Die Identifikationsnummer der Marktlokation (MaLo-ID) dient der eindeutigen Identifizierung einer Verbrauchsstelle, Wohnung oder Einspeisestelle.
Identifikationsnummer der Messlokation (Zählpunktbezeichnung)
Die Identifikationsnummer der Messlokation (Zählpunktbezeichnung) dient der eindeutigen Identifizierung der Messeinrichtung.
Messstellenbetrieb
Der Messstellenbetrieb umfasst den Einbau, Betrieb und Wartung von Messeinrichtungen, die Ab- und Auslesung der Messeinrichtung und die Weitergabe der Daten an die Berechtigten.
Netzentgelte
Die Netzentgelte sind Entgelte für den Transport und die Verteilung der Energie sowie die damit verbundenen Dienstleistungen; bestimmte staatliche Abgaben werden mit den Netzentgelten erhoben
Energiesteuer (Erdgassteuer)
Die Energiesteuer(Erdgassteuer) ist eine durch das Energiesteuergesetz geregelte Steuer auf den Energieverbrauch.
Thermische Gasabrechnung, Verbrauch / Thermische Energie
Bei Gas wird das Volumen in Kubikmetern (m³) gemessen. Dieses wird in Kilowattstunden (kWh) umgerechnet, damit die Energiemenge ohne den Einfluss von Druck und Temperatur abgerechnet werden kann. Dazu wird nach eichrechtlich anerkannten Regeln der Verbrauch in m³ mit der Zustandszahl z (z-Zahl) und dem Brennwert multipliziert. Große Abnahmestellen haben entsprechende Messeinrichtungen, um Druck und Temperatur direkt vor Ort zu messen. Dort entfällt die Umrechnung.
Verbrauch (kWh)
Der Verbrauch ist die in Anspruch genommene Arbeit und wird in Kilowattstunden (kWh) ausgewiesen.
Verbrauchspreis oder Arbeitspreis
Der Verbrauchs-/Arbeitspreis bezeichnet den Preis für eine in Anspruch genommene Kilowattstunde Energie.
Zustandszahl (z-Zahl)
Die Zustandszahl z ist ein Korrekturfaktor, mit dem der Einfluss von Druck und Temperatur auf den Energieinhalt des Gasvolumens aufgehoben wird.
FAQ zu Allgemeinen E-Rechnungen
Wichtige Informationen zu XRechnungen
Die XRechnung ist ein Standard für die Art und die technische Zusammensetzung der Rechnungsinformationen in einem XML-Datensatz. Dieser XML-Datensatz entspricht einer elektronischen Rechnung. Der Standard ermöglicht den Empfang und die Weiterverarbeitung durch unterschiedliche Softwaresysteme. Der Standard XRechnung wird von der KoSIT (Koordinierungsstelle für IT-Standards) im Auftrag des IT-Planungsrats betrieben.
Welcher Standard verwende ich für die Rechnungsstellung an den Bund?
Für die Ausstellung von elektronischen Rechnungen an die Bundesverwaltung ist grundsätzlich der Standard XRechnung in der jeweils aktuellen Fassung zu verwenden. Zusätzlich kann jeder andere Standard verwendet werden, wenn dieser den Anforderungen der europäischen Norm für die elektronische Rechnungsstellung (EN 16931), der E-RechV und den Nutzungsbedingungen der Rechnungseingangsplattformen des Bundes entspricht.
Das ZUGFeRD 2.2.0 Profil XRECHNUNG erfüllt grundsätzlich die Anforderungen und ermöglicht das Einreichen von Rechnungen über die Plattformen des Bundes.
Welche Formate zur Erstellung einer E‑Rechnung gibt es und was sind die Unterschiede?
Zur Erstellung von E-Rechnungen muss ein Datenformat verwendet werden, das den Anforderungen aus
- der europäischen Norm für die elektronische Rechnungsstellung EN 16931,
- der E-Rechnungsverordnung des Bundes (E-RechV) und
- den Nutzungsbedingungen der jeweilig genutzten Rechnungseingangsplattform des Bundes
entspricht. Für die Ausstellung von elektronischen Rechnungen an die Bundesverwaltung ist grundsätzlich der Standard XRechnung in der jeweils gültigen Fassung zu verwenden. Zusätzlich kann jedes andere Rechnungsformat (z. B. ZUGFeRD Version 2.2.0 im Profil XRECHNUNG als rein strukturierte XML-Datei) verwendet werden, wenn dieser den oben genannten Anforderungen entspricht.
Wofür steht die Bezeichnung „XRechnung“?
XRechnung bezeichnet den Standard zur elektronischen Rechnungsstellung bei öffentlichen Auftraggebern und setzt die Richtlinie 2014/55/EU in Deutschland maßgeblich um. Der Standard XRechnung wird von der KoSIT (Koordinierungsstelle für IT-Standards) im Auftrag des IT-Planungsrats betrieben. Ferner koordiniert KoSIT die Weiterentwicklung von XRechnung unter Einbezug von Experten aus Bund, Ländern und Kommunen.
Weiterführende Informationen können auf der Internetseite der KoSIT abgerufen werden.
Für die Ausstellung von elektronischen Rechnungen an die Bundesverwaltung ist grundsätzlich der Standard XRechnung in der jeweils aktuellen Fassung zu verwenden. Zusätzlich kann jeder andere Standard (z. B. ZUGFeRD 2.2.0 Profil XRECHNUNG, als rein strukturierte XML-Datei) verwendet werden, wenn dieser den Anforderungen der europäischen Norm für die elektronische Rechnungsstellung (EN 16931), der E-Rechnungsverordnung des Bundes (E-RechV) und den Nutzungsbedingungen der Rechnungseingangsplattformen des Bundes entspricht.
Was regelt der Standard XRechnung?
Die EU-Richtlinie EN 16931 gibt die Verwendung des strukturierten Datenformats XML für den elektronischen Rechnungsaustausch vor, welches eine automatisierte Rechnungsverarbeitung ermöglicht. Ein standardisiertes semantisches Datenmodell beschreibt die Informationselemente einer Rechnung und deren gegenseitige Beziehung und Datentypen (z. B. den Käufernamen). Die Vorgabe der Syntax (UBL und UN/CEFACT) stellt eine einheitliche technische Umsetzung der E-Rechnung in der EU sicher.
Als nationale Implementierung des Datenmodells ergänzt der Standard XRechnung in Deutschland die EU-Norm um 21 spezifische, nationale Geschäftsregeln, die auf einzelne Informationselemente und Beziehungen zwischen Informationselementen anzuwenden sind. Somit berücksichtigt der Standard die nationalen Vorgaben – wie die E-RechV – für die Rechnungsstellung. Dies wird am Beispiel des Informationselements „Käuferreferenz” im Feld „BT-10” deutlich:
- Bei der „Käuferreferenz“ (BT-10) handelt es sich gemäß der EU-Norm um ein optionales Inhaltselement.
- Bei der „Käuferreferenz“ (BT-10) handelt es sich gemäß Deutschem Recht um eine Pflichtangabe. Der Standard XRechnung definiert somit die „Käuferreferenz“ als ein verpflichtendes Inhaltselement, in dem die sogenannte Leitweg-ID anzugeben ist.
Der Standard XRechnung wird regelmäßig überprüft und aktualisiert. Änderungen werden 6 Monate vor Inkrafttreten bekannt gegeben. Die aktuell gültige Fassung der vollständigen Dokumentation des Standards ist auf der Internetseite der KoSIT hinterlegt.
Was ist der Unterschied zwischen XRechnung und E‑Rechnung?
Eine elektronische Rechnung (E‑Rechnung) nach EU-Norm ist eine in einem strukturierten Format ausgestellte Rechnung, die elektronisch übermittelt und empfangen wird und eine automatische sowie elektronische Verarbeitung ohne Medienbrüche ermöglicht.
- Als reines semantisches Datenformat konzipiert, ermöglicht die E-Rechnung Rechnungsdaten ohne Medienbruch in die verarbeitenden Systeme zu importieren.
- Sie basiert auf einem strukturierten XML-Format, das in erster Linie nur der maschinellen Lesbarkeit dient.
- Durch den Einsatz von Anzeigeprogrammen (sog. Visualisierungsprogramme) kann der XML-Datensatz für den Menschen lesbar dargestellt werden.
Es gibt verschiedene Standards bzw. Spezifikationen, welche die elektronische Rechnungsstellung ermöglichen, bspw. der Standard XRechnung.
- Der Standard XRechnung repräsentiert eine nationale Ausgestaltung der Europäischen Norm EN 16931, eine sogenannte Core Invoice Usage Specification (CIUS).
- Damit jedes Mitgliedsland den europäischen Standard EN 16931 mit seinen länderspezifischen Anforderungen umsetzen kann, definiert jedes Land seine spezifische CIUS.
- In Deutschland nennt sich die nationale Ausgestaltung des Standards XRechnung und wird zur einheitlichen Umsetzung der Anforderungen der öffentlichen Auftraggebenden in Bund, sowie einem Großteil der Länder und Kommunen verwendet.
Wie setze ich den Standard XRechnung um?
Abhängig davon wie der Rechnungsausgang bisher umgesetzt ist, bestehen unterschiedliche Möglichkeiten zur Umsetzung:
Nutzen Sie einen Serviceprovider oder eine marktübliche Software zur Rechnungsstellung? Kontaktieren Sie den Hersteller und erkundigen Sie sich, ob die elektronische Rechnungsstellung unterstützt wird.
Nutzen Sie ein eigenes System? Klären Sie mit Ihrer IT, welche Schritte notwendig sind, um E-Rechnungen konform zur EU-Norm EN 16931 sowie zur deutschen Rechtslage zu erstellen. Die aktuell gültige Fassung der vollständigen Dokumentation des Standards ist auf der Internetseite der KoSIT hinterlegt.
Sollten Sie kein Rechnungsausgangssystem im Einsatz haben oder eine Übergangslösung benötigen, machen Sie sich mit der Weberfassung der ZRE/OZG-RE vertraut.
Wie visualisiere ich ein XRechnungs-Datensatz?
Der XML-Datensatz der XRechnung muss vom Rechnungsempfangenden für die Weiterverarbeitung visualisiert werden. Üblicherweise wird die Visualisierung des Datensatzes innerhalb des (ERP-)Systems vorgenommen. Die KoSIT bietet ebenfalls eine entsprechende Visualsierungskomponente an. Die Komponenten zur Unterstützung der Visualisierung innerhalb eines Systems sind öffentlich im XRechnungs-GitHub verfügbar.
Kann die Rechnung nicht systemgestützt und automatisiert verarbeitet werden, wird die Anwendung einer Visualisierungslösung empfohlen, um mögliche Fehler besser „erkennen“ zu können.
Auch Rechnungsstellende/-sendende benötigen im Rahmen der Prozesse im Rechnungswesen die Möglichkeit, die Originalrechnung – den XML-Datensatz – zu visualisieren. Die Funktionalität kann integriert im elektronischen Rechnungsausgangssystem vorhanden sein oder über eine dedizierte Visualisierungslösung sichergestellt werden.
Was bedeutet CIUS im Kontext XRechnung?
Der Standard XRechnung repräsentiert eine nationale Ausgestaltung der Europäischen Norm EN 16931, eine sogenannte Core Invoice Usage Specification (CIUS). Die nationale Ausgestaltung der Richtlinie in den anderen Mitgliedstaaten der EU spezifiziert diese um lokale Vorgaben innerhalb des durch die Norm vorgegebenen Rahmens.
Was ist (die) KoSIT?
KoSIT steht für „Koordinierungsstelle für IT-Standards“.
Im Kontext der elektronischen Rechnungsstellung ist die KoSIT verantwortlich für den Betrieb des Standards XRechnung und der „Extension XRechnung“.
Der XML-basierte Standard XRechnung wird von der KoSIT im Auftrag des IT-Planungsrats betrieben und besteht aus verschiedenen Komponenten, die die technische Umsetzung unterstützen. Der Standard wurde im Rahmen des Steuerungsprojekts E-Rechnung von Expertinnen und Experten aus Bund, Ländern und Kommunen entwickelt.
Gemäß dem Beschluss des IT-Planungsrats vom 22.06.2017 ist XRechnung der grundsätzlich maßgebliche Standard für die Umsetzung der Richtlinie 2014/55/EU in Deutschland. Damit bildet XRechnung eine verlässliche Basis für den Austausch elektronischer Rechnungen mit deutschen Verwaltungen.
Wer betreibt den Standard XRechnung?
Der XML-basierte Standard XRechnung, sowie die Extension XRechnung wird von der KoSIT, der Koordinierungsstelle für IT-Standards, im Auftrag des IT-Planungsrats* betrieben und besteht aus verschiedenen Komponenten, die die technische Umsetzung der E-Rechnung unterstützen. Der Standard wurde im Rahmen des Steuerungsprojekts E‑Rechnung von Expertinnen und Experten aus Bund, Ländern und Kommunen entwickelt.
Gemäß dem Beschluss des IT-Planungsrats vom 22.06.2017 ist XRechnung der grundsätzlich maßgebliche Standard für die Umsetzung der Richtlinie 2014/55/EU in Deutschland. Damit bildet XRechnung eine verlässliche Basis für den Austausch elektronischer Rechnungen mit deutschen Verwaltungen.
*Der IT-Planungsrat ist das zentrale Gremium für die föderale Zusammenarbeit in der Informationstechnik
Wichtige Informationen zu Peppol
Peppol (ursprünglich für „Pan-European Public Procurement OnLine“) ist eine internationale Infrastruktur der Non-Profit Organisation OpenPeppol zur Standardisierung und Vereinfachung öffentlicher Beschaffungsprozesse. Mit Hilfe der Infrastruktur des Peppol-Netzwerks können E‑Rechnungen an alle Rechnungsempfangende übermittelt werden, die an die ZRE und OZG‑RE angeschlossen sind. Peppol ermöglicht dabei eine medienbruchfreie und einfache Abwicklung ohne Systemwechsel (machine-to-machine) und damit auch den Versand einer großen Menge an E‑Rechnungen, sogenannte Massenexporte. Für grundsätzliche Informationen rund um das Thema Peppol, werden Sie auf der Seite der Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) fündig (https://xeinkauf.de/peppol/).
Was ist Peppol?
Peppol (ursprünglich für “Pan-European Public Procurement Online“) ist aus einem internationalen Projekt mit dem Ziel der Standardisierung öffentlicher Beschaffungs- und Vergabeverfahren innerhalb der europäischen Union und weltweit entstanden. Hinter Peppol steht die Organisation OpenPeppol AISBL, eine Non-Profit-Organisation nach belgischem Recht mit Sitz in Brüssel.
Kerninhalt der Vision von Peppol ist die Schaffung einer gesamtheitlichen Interoperabilität unterschiedlicher Systeme. Das heißt, dass jedes Unternehmen in einem Land, mit einer Verwaltung im gleichen, oder einem anderen Land sämtliche Beschaffungs- und Vergabeverfahren elektronisch abwickeln kann. Dazu stellt Peppol ein Netzwerk zur Übermittlung von Daten (das Peppol eDelivery Network) sowie Spezifikationen für die zu übermittelnden Dokumente zur Verfügung (Peppol Business Interoperability Specifications ‚BIS’). Größter Vorteil dieser Organisation ist der vollständige, elektronische, medienbruchfreie und automatisierte Austausch von Dokumenten. Auch ein automatisierter Massenimport von Dokumenten kann über Peppol erfolgen.
Das Peppol-Netzwerk wird von den Rechnungseingangsplattformen ZRE für die unmittelbare Bundesverwaltung und OZG-RE für die mittelbare Bundesverwaltung sowie kooperierenden Länder genutzt, um es Lieferanten als Rechnungssendern zu ermöglichen, E-Rechnungen automatisiert zu versenden.
Technisch basiert Peppol auf dem sogenannten “4-Corner-Modell”.
Weitere Informationen zu Peppol finden Sie unter der Internetseite von Peppol sowie den Seiten der KoSIT.
Wie funktioniert der Versand und Empfang von Dokumenten via Peppol?
Ziel von Peppol ist, den Sendenden und den Empfangenden von elektronischen Dokumenten miteinander zu verbinden. Sendender, sowie Empfangender benötigen dazu einen sogenannten Access Point, um Zugriff auf das Peppol-Netzwerk zu erhalten.
Der Rechnungssendende sendet seine Rechnung an einen Access Point. Dieser erreicht mittels der Peppol-Receiver-ID den Access Point des Empfangenden. Mit Bereitstellung der E-Rechnung an den Access Point des Empfangenden stellt dieser die Rechnung dem Empfangenden zur Verfügung. Die Rechnungseingangsplattformen ZRE und OZG-RE sind hierbei an dem Access Point des Empfangenden (der Behörden und Einrichtungen der Bundesverwaltung) angeschlossen.
Die Leitweg-ID wird nun innerhalb der Rechnungseingangsplattformen als Adressierung der Behörden und Einrichtungen verwendet. Sobald der Liefernde in der entsprechenden Plattform die Peppol-Receiver-ID seines Auftraggebenden hinterlegt hat und der Übertragungskanal Peppol freigeschaltet ist, kann sie oder er E-Rechnungen via Peppol an die Rechnungseingangsportale versenden. Die angeschlossenen Behörden und Einrichtungen können somit wie gewohnt auch über Peppol eingereichte E-Rechnungen in der jeweiligen Plattform abholen und in Ihren Systemen weiterverarbeiten.
Durch die Nutzung von Peppol ergibt sich für den Rechnungssendenden ein einheitlicher und zentraler Kanal für den Versand von E-Rechnungen. Dabei muss die genutzte Rechnungseingangsplattform des Empfangenden auch an Peppol angeschlossen sein. Bitte erfragen Sie dies sowie die anzugebende Peppol-Receiver-ID bei Ihren Auftraggebenden.
Hinweis: Bei Einrichtungen der unmittelbaren Bundesverwaltung, sowie an die OZG-RE angeschlossenen Organisationen der mittelbaren Bundesverwaltung und angeschlossener (kooperierender) Bundesländer ergibt sich die Peppol-Participant-ID aus der Kombination von Präfix und Leitweg-ID „0204:LeitwegID“. Bei anderen Bundesländern können sich die Peppol-Participant-ID und die Leitweg-ID voneinander unterscheiden.
Was ist die Peppol-Participant-ID und wie kann ich diese beantragen?
Damit ein Sendender den richtigen Empfangenden eindeutig adressieren kann, müssen sich alle Access Points und die dazugehörigen Empfänger kennen.
Der Peppol-Participant-Identifier (Peppol-ID) dient im Peppol-Netzwerk dazu, einen Teilnehmenden eindeutig zu identifizieren. Dabei wird zwischen der Sender-ID und der Receiver-ID unterschieden. Diese müssen nicht beantragt, sondern können selbst vergeben werden. Für Peppol-Sender-IDs empfiehlt es sich, die Global Location Number (GLN) mit dem Präfix 0088 oder die Umsatzsteuer-ID (VAT-ID) mit dem Präfix 9930 zu verwenden.
Rechnungsempfangende benötigen eine Receiver-ID. Bei allen öffentlichen Einrichtungen, die an die ZRE oder OZG-RE angeschlossen sind, entspricht die Peppol-Receiver-ID der Leitweg-ID mit dem entsprechenden Präfix „0204“ (z. B. 0204:991-33333TEST-33).
Empfangende müssen zudem in einem SMP-Server (Service Metadata Publisher) registriert werden, damit sie technisch gefunden werden können. Im SMP werden zu einem Participant noch weitere Metadaten gespeichert, beispielsweise welche Dokumententypen der Teilnehmende annehmen/verarbeiten kann und an welchem Access Point dieser angeschlossen ist. Die Peppol-ID eines Rechnungssendenden muss, solange dieser nur senden will, nicht in einem SMP registriert werden.
Beispiele für Peppol-Sender-IDs (Rechnungssender):
- 9930:Umsatzsteueridentifikationsnummer
- 0088:GlobalLocationNumber
Beispiel für Peppol-Receiver-IDs (Rechnungsempfänger):
- 0204:LeitwegID
Wie hängen die Peppol-Participant-ID und die Leitweg-ID zusammen?
Für die deutschen öffentlichen Auftraggebenden wurde im Rahmen der Entwicklung des Standards XRechnung ein Schema für eine Adressierungscodierung definiert, die sogenannte Leitweg-ID. Diese Adressierungscodierung wurde bei Peppol für die Adressierung im Transportnetzwerk als zulässiges Schema für den Participant-Identifier registriert. Für Unternehmen in Deutschland ist darüber hinaus bereits das Schema der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (VAT ID) und der Global Location Number bei Peppol registriert. Privatwirtschaftliche Auftraggebende können damit ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer als Peppol-Participant-Identifier für eine eindeutige Identifizierung als Sendende oder Empfangende nutzen. Für öffentliche Auftraggebende steht die Leitweg-ID als gültiges Schema zur Verfügung.
Der Zusammenhang zwischen einer Peppol-Participant-ID und der Leitweg-ID oder der Umsatzsteueridentifikationsnummer wird über unterschiedliche Präfixe hergestellt. Aus einem vierstelligen Zahlencode, der vor die Leitweg ID oder Umsatzsteueridentifikationsnummer gesetzt wird, ergibt sich die Peppol-Participant-ID:
- Präfix 0204 + Leitweg-ID → 0204:Leitweg-ID
- Präfix 9930 + Umsatzsteueridentifikationsnummer → 9930:Umsatzsteueridentifikationsnummer
- Präfix 0088 + Global Location Number → 0088:Global Location Number
Damit der Austausch von Dokumenten im Peppol-Netzwerk standardisiert verläuft, wird die Kommunikation anhand der sogenannten BIS (Business Interoperability Specification) umgesetzt. Diese regelt einen eindeutigen Standard für den Dokumentenaustausch innerhalb des Netzwerks. Soll zum Beispiel eine XRechnung an einen Empfangenden via Peppol gesendet werden, bildet ein Standard Business Document (SBD) den technischen Umschlag, in den die XRechnung (zusammen mit dem sog. SBD-Header) eingebettet ist. In diesem SBD-Header muss die Receiver-ID enthalten sein, in der eingebetteten E-Rechnung selbst darf allerdings in dem Feld BT-10 Buyer Reference nur die Leitweg-ID des Empfangenden enthalten sein.
Wichtige Informationen zur Leitweg-ID
Die Leitweg-ID ist eine eindeutige Zeichenkette. Sie dient dazu, bei der Übertragung elektronischer Rechnungen den öffentlichen Auftraggebenden zu identifizieren und Rechnungen an diesen zu adressieren. Sie muss auf jeder elektronischen Rechnung an öffentliche Auftraggebende der Bundesverwaltung als Pflichtangabe übermittelt werden. Rechnungsstellende erhalten die Leitweg-ID, welche in der E-Rechnung einzutragen ist, von ihrem Auftraggebenden. Rechnungsstellende müssen keine eigene Leitweg-ID beantragen.
Was ist die Leitweg-ID?
Um eine elektronische Rechnung durch den Rechnungsstellenden bzw. -sendenden adressieren zu können, muss eine rechnungsempfangende Peron der Bundesverwaltung eindeutig identifiziert und adressierbar sein.
Die Leitweg-ID ermöglicht eine elektronische Adressierung und Weiterleitung der E-Rechnung durch die Zentralen Rechnungseingangsplattformen des Bundes an die angeschlossenen ERP- bzw. Freigabesysteme der Behörden und Einrichtungen der Bundesverwaltung.
Die Leitweg-ID wird im Standard XRechnung im Feld „Käuferreferenz“ (BT-10) angegeben und muss als Pflichtangabe auf jeder E-Rechnung übermittelt werden.
Rechnungsstellende an die Bundesverwaltung benötigten keine eigene Leitweg-ID.
Ab dem 01.01.2025 wird – begleitet von Übergangsvorschriften – auch bei Umsätzen zwischen inländischen Unternehmern verpflichtend eine elektronische Rechnung (E-Rechnung) zu verwenden sein. Für rechtliche Fragen zur Rechnungsstellung im B2B-Bereich ist das Bundesministerium der Finanzen zuständig. Unternehmen benötigen für diesen Zweck auch keine eigene Leitweg-ID, da diese nur zur Adressierung von Rechnungsempfangende in der Bundesverwaltung verwendet wird.
Wie ist eine Leitweg-ID aufgebaut?
Die Leitweg-ID setzt sich grundsätzlich aus drei Bestandteilen zusammen:
- Grobadressierung,
- Feinadressierung und
- Prüfziffer.
Anhand der so genannten Grobadressierung wird unterschieden, ob der Rechnungsempfänger zur Bundesverwaltung oder zu einem Bundesland gehört:
- 991: Der Rechnungsempfangende ist Teil der unmittelbaren Bundesverwaltung oder ein Verfassungsorgan und empfängt elektronische Rechnungen über die ZRE.
- 992: Der Rechnungsempfangende ist Teil der mittelbaren Bundesverwaltung und empfängt elektronische Rechnungen über die OZG-RE.
- 993: Der Rechnungsempfangende ist Teil der mittelbaren Bundesverwaltung und empfängt über eine eigene Lösung (weder ZRE noch OZG-RE) elektronische Rechnungen.
Weitere Informationen zur Grobadressierung in Bundesländern finden Sie unter den Leitweg-ID Format-Spezifikationen auf der Website der KoSIT.
Wann verwende ich eine Leitweg-ID und wann nicht?
Die Leitweg-ID ist auf jeder elektronischen Rechnung an öffentliche Auftraggebende der Bundesverwaltung anzugeben. Diese stellt sicher, dass beispielsweise eine Behörde der Bundesverwaltung eindeutig identifiziert und adressiert werden kann. Sie wird an öffentliche Auftraggebende vor deren Anschluss an die Rechnungseingangsplattformen vergeben. Rechnungsstellende benötigen keine eigene Leitweg-ID.
Bei der Bestellung teilt der Rechnungsempfangende (Auftraggebende) dem Rechnungsstellenden (Auftragnehmenden) die Leitweg-ID mit. Die Plattformen ZRE und OZG-RE haben zudem im Rahmen der Weberfassung ein Verzeichnis der angebunden Leitweg-IDs. Bitte verwenden Sie jedoch ausschließlich die bei Auftragserteilung benannte Identifikationsnummer für eine zugehörige elektronische Rechnung.
Hat jeder Rechnungsempfangender der Bundesverwaltung nur eine Leitweg-ID oder sind mehrere möglich?
Ein Rechnungsempfangender der Bundesverwaltung hat mindestens eine Leitweg-ID. Es können mehrere Leitweg-IDs pro Behörde oder Einrichtung genutzt werden. Es ist jeder Behörde oder Einrichtung überlassen, wie viele Leitweg-IDs beantragt werden.
Die Ausgestaltung der Leitweg-ID in einer Behörde/Einrichtung basiert auf der Organisation der internen Rechnungsbearbeitung. Behörden und Einrichtungen mit mehreren Leitweg-IDs stellen über die Angabe der entsprechenden Leitweg-IDs sicher, dass die Rechnung direkt an den zuständigen Bereich für die Bewirtschaftung adressiert wird. Es ist daher essentiell, dass stets die im Auftrag angegebene Leitweg-ID für die Rechnungsstellung verwendet wird. Bei Fragen zur Leitweg-ID Ihres Auftrags wenden Sie sich bitte direkt an den Rechnungsempfangenden. Weitere Informationen zur Leitweg-ID finden Sie auf der Website des XStandards Einkauf. Für Behörden oder Einrichtungen des Bundes ist das Zentrale Finanzwesen des Bundes (ZFB) für die Vergabe der Leitweg-IDs zuständig. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an erechnung@zrb.bund.de.
Wo erhalte ich als Rechnungsempfangender der Bundesverwaltung eine neue/weitere Leitweg-ID?
Die Vergabe der Leitweg-IDs wird auf Ebene von Bund und Ländern geregelt:
- Für Bundesbehörden und auf Ebene des Bundes angebundene öffentliche Auftraggebende ist das Zentrale Finanzwesen des Bundes ZFB zuständig. Weitere Informationen zur Beantragung der Leitweg-ID können beim ZFB über unser Kontaktformular angefragt werden.
- Die ausgebenden Stellen für Landesbehörden können der jeweils aktuellen Ländersynopse der KoSIT entnommen werden (Dokument aktueller Umsetzungsstand der Länder).
FAQ zu ZUGFeRD
Wichtige Informationen zu ZUGFeRD
ZUGFeRD ist ein branchenübergreifendes Datenformat für den elektronischen Datenaustausch, das vom Forum elektronische Rechnung Deutschland (FeRD) – mit Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie – erarbeitet wurde.
Was ist ZUGFeRD?
- Visuelle Darstellung der Rechnung als PDF in PDF A/-3 Format (wie bisher auch).
- Die Inhalte der Rechnung sind zusätzlich als XML Datei in das PDF eingebettet. Eine XML-Datei ist für die weitere Datenverarbeitung maschinell auslesbar.
- Das ZUGFeRD-Datenformat basiert auf der Richtlinie 2014/55/EU vom 16. April 2014 über die elektronische Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen und auf der am 28. Juni 2017 veröffentlichten Norm EN16931. Zudem werden die Cross-Industry-Invoice (CII) von UN/CEFACT und die ISO-Norm 19005-3:2012 (PDF/A-3) ab ZUGFeRD 2.0 berücksichtigt.
Welche Vorteile bietet das ZUGFeRD Datenformat und für wen wurde es eingeführt?
Ziel von ZUGFeRD ist es elektronische Rechnungen zwischen zwei Unternehmen schnell und ohne großen Aufwand auszutauschen. Die Entwicklung eines einheitlichen Formats soll einzelne Formatabsprachen überflüssig machen. ZUGFeRD kann von großen Unternehmen verwendet werden, ist aber insbesondere auch für KMU´s sowie die öffentliche Verwaltung gedacht.
Wie funktioniert der Versandt?
Eine ZUGFeRD Rechnung setzt den elektronischen Versand der Rechnung voraus. Die Rechnung wird dann als PDF Datei an eine von Ihnen gewünschte E-Mail Adresse geschickt.
Wie erhalte ich meine Energierechnungen im ZUGFeRD Format?
Melden Sie sich einfach bei Ihrer persönlichen Kundenbetreuung und sprechen Sie sie auf das ZUGFeRD Datenformat an. Sollte Ihnen dieser aktuell nicht bekannt sein, schreiben Sie uns gern eine E-Mail: geschaeftskunden-abrechnung@gasag.de
Welche Informationen benötigen wir von Ihnen?
- Welche Vertragskonten sind betroffen? Alle oder nur bestimmte?
- An welche E-Mail Adresse soll die Rechnung gesendet werden?
- Wie lautet Ihre Referenznummer?
Sind zusätzliche Anforderungen möglich?
Auf Wunsch prüfen wir gerne auch besondere Anfragen wie zum Beispiel zusätzliche Papierrechnung zur digitalen Rechnung. Für zusätzliche Anforderungen können gegebenfalls zusätzliche Kosten entstehen.
FAQ zum „CO2-Preis“
Wichtige Informationen zum „CO2-Preis“
Die Bundesregierung strebt eine umfassende Klimawende durch die Reduktion von Emissionen an. Ab dem 1. Januar 2021 werden durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) Änderungen in Kraft treten.
Was ist das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG)?
Das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) ist Bestandteil der von der Bundesregierung geplanten Energie- und Klimawende. Das vom deutschen Bundestag beschlossene Gesetz ist am 20.12.2019 in Kraft getreten.
In diesem Gesetz wurde festgelegt, dass ab 1. Januar 2021 für den CO2-Ausstoß von Kraft- und Brennstoffen (zum Beispiel Öl, Benzin oder Erdgas) Emissionszertifikate erworben werden müssen. Genauer gesagt von den „Inverkehrbringern und Lieferanten der Brenn- und Kraftstoffe“. Damit sind die Versorger, wie zum Beispiel GASAG, gemeint, da diese das Erdgas liefern bzw. in den Verkehr bringen.
Die anfallenden Kosten für die Emissionszertifikate werden dazu führen, dass Brennstoffe (zum Beispiel Erdgas) teurer werden. Dies ist vom Gesetzgeber so vorgesehen – denn die höheren Kosten sollen Anreize schaffen, mehr Energie zu sparen, auf klimaschonende Technologien umzusteigen und mehr erneuerbare Energien zu nutzen.
Was ist gemeint mit „CO2-Steuer“, „CO2-Abgabe“ oder „CO2-Preis“?
Als Energielieferant sind wir dazu verpflichtet, CO2-Zertifikate für das an Sie gelieferte Erdgas zu erwerben und an die zuständigen Behörden weiterzugeben. Der Preis hierfür ist gesetzlich fixiert. Aus diesem Grund wird oft von einer „CO2-Steuer“, „CO2-Abgabe“ oder der „CO2-Bepreisung" gesprochen. Jedoch handelt es sich hierbei nicht um eine Steuer oder Abgabe, sondern um die Kosten für den Kauf der Emissionszertifikate aus dem nationalen Brennstoffemissionshandel.
Was bedeutet das für mein Unternehmen?
Als Energieversorger sind wir ab 2021 dazu verpflichtet, für das Liefern bzw. in den Verkehr bringen von Brennstoffen Zertifikate zu erwerben und an die Brennstoffemissions-handelsstelle (DEHSt) abzugeben. Die Kosten für diese Zertifikate (pro Tonne CO2) sind bis 2025 vom Gesetzgeber festgeschrieben. Danach werden sie in einem Auktionsverfahren ermittelt.
Für die kommenden Jahre ergeben sich für den Kauf der Zertifikate folgende Kosten:
2024: 45 €/t0, 8163 ct/kWh
2025: 55 €/t0, 9977 ct/kWh
Emissionsfaktor nach EBEV 2030 (gültig ab einschließlich 2023): 0,18139464 kg CO2/kWh
Das bedeutet für Sie:
Im Rahmen der vertraglichen Vereinbarung (bezüglich der allgemeinen Preisbestandteile) verrechnen wir die Kosten eins-zu-eins an Ihr Unternehmen weiter. Damit steigen Ihre Kosten für die Lieferung von Erdgas um die oben genannten Beträge. Eine detaillierte Preisinformation erhalten Sie per Post.
Wie werden die Kosten an mich weiterverrechnet?
Der neue Preisbestandteil wird separat auf Ihrer Rechnung aufgeführt.
Bei Kundinnen und Kunden mit SLP-Zähler (ohne registrierende Leistungsmessung) werden die Kosten durch die Jahresverbrauchsabrechnung weitergegeben.
Bei Kundinnen und Kunden mit rLM-Zähler (registrierende Leistungsmessung) werden die Kosten direkt mit der monatlichen Abrechnung weitergegeben.
Sind Bio- und Ökogas ebenfalls betroffen?
Nicht-nachhaltiges Biogas und Ökogas unterliegen im Sinne des BEHG dem CO2-Preis analog normalem Erdgas.
Ist (Öko-)Strom ebenfalls von den Belastungen betroffen?
Strom ist nicht von den Belastungen aus dem BEHG betroffen. Die Emissionen der Stromerzeugung sind in Deutschland bereits im Europäischen Emissionshandel (EU-ETS) erfasst. Seit 2005 müssen Betreibende für jede Tonne emittiertes CO2 eine Emissionsberechtigung abgeben.
Was ist das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG)?
Das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) ist Bestandteil der von der Bundesregierung geplanten Energie- und Klimawende. Das vom deutschen Bundestag beschlossene Gesetz ist am 20.12.2019 in Kraft getreten.
In diesem Gesetz wurde festgelegt, dass ab 1. Januar 2021 für den CO2-Ausstoß von Kraft- und Brennstoffen (zum Beispiel Öl, Benzin oder Erdgas) Emissionszertifikate erworben werden müssen. Genauer gesagt von den „Inverkehrbringern und Lieferanten der Brenn- und Kraftstoffe“. Damit sind die Versorger, wie zum Beispiel GASAG, gemeint, da diese das Erdgas liefern bzw. in den Verkehr bringen.
Die anfallenden Kosten für die Emissionszertifikate werden dazu führen, dass Brennstoffe (zum Beispiel Erdgas) teurer werden. Dies ist vom Gesetzgeber so vorgesehen – denn die höheren Kosten sollen Anreize schaffen, mehr Energie zu sparen, auf klimaschonende Technologien umzusteigen und mehr erneuerbare Energien zu nutzen.
FAQ zum „CO2-Kostenaufteilungsgesetz“
Wichtige Informationen zum „CO2-Kostenaufteilungsgesetz“
Am 1. Januar 2023 ist das „Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz“ („CO2KostenAufG“) in Kraft getreten. Es regelt für vermietete Gebäude die Aufteilung des anfallenden CO2-Preis zwischen Vermieterinnen oder Vermieter und Mieterinnen oder Mieter. GASAG ist als Gaslieferant verpflichtet, Angaben auf den Rechnungen zu machen, die der Vermieterin oder dem Vermieter eine weitere Verrechnung des CO2-Preises ermöglichen. Wir stellen alle relevanten energiewirtschaftlichen Daten in der Erdgasrechnung bereit, damit die Vermieterin oder dem Vermieter eine Aufteilung der CO2-Kosten zwischen Mietenden und Vermietenden berechnen kann.
Welche Angaben sind nach dem CO2KostAufG in Ihrer Erdgasrechnung enthalten?
In einer Erdgasrechnung wird die gelieferte Gasmenge (kWhHs) nach dem Brennwert angegeben, weil dieser den gesamten Energieinhalt des Gases widerspiegelt. Der Heizwert (kWhHi) ist hingegen die Energiemenge, die Sie tatsächlich als Wärme nutzen können und der Wert der für die weitere Berechnung der CO2-Kostenaufteilung relevant ist.
Der Umrechnungsfaktor von 0,903 ergibt sich aus dem Verhältnis von Hi zu Hs (nach EBeV 2030, Anlage 2, Teil 4). Mit Hilfe des heizwertbezogenen Emissionsfaktors (kg CO2∕kWhHi) weisen wir Ihnen darüber hinaus die Brennstoffemissionen (kg CO2) Ihres Erdgasverbrauchs aus. Die gesamten CO2 Kosten (Euro) finden Sie ebenfalls in Ihrer Rechnung.
Hinweis an Mietende (§ 3 Abs. 1 Nr. 5 CO2KostAufG)
Sind Sie Mietende, können Sie von Ihrer Vermieterin oder Ihrem Vermieter verlangen, dass sie oder er sich an den Kohlendioxidkosten beteiligt, die im Rahmen der Versorgung der von Ihnen genutzten Räume mit Wärme und Warmwasser anfallen. Dieser gesetzliche Anspruch besteht für Wohngebäude auf der Grundlage des § 6 Abs. 2 CO2KostAufG. Wenden Sie sich dazu bitte mit dieser Information an Ihren Vermietenden.
Was ist der Zweck des CO2KostAufG?
Das CO2KostAufG regelt die Aufteilung von CO2-Kosten zwischen Mietenden und Vermietenden, die in den Kosten der Wärmeversorgung des Gebäudes enthalten sind. Mietende sollen zu energieeffizientem Verhalten angehalten werden und Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer einen Anreiz zu Investitionen in klimaschonende Heizungssysteme beziehungsweise zu energetischen Sanierungen erhalten.
Für wen gilt das CO2KostAufG?
Aus dem CO2KostAufG folgen neue Verpflichtungen für Vermietende sowie für GASAG als Energielieferant.
Ab wann gilt das CO2KostAufG?
Für Abrechnungszeiträume ab 1. Januar 2023.
Wer ist verantwortlich für die Aufteilung der CO2-Kosten auf den Mietenden?
In der Umsetzung dieser CO2-Kostenteilung hat der Vermietende nicht nur die Kohlendioxidkosten für die jeweiligen Anteile zu ermitteln, sondern auch die Kosten im Rahmen der jährlichen Heizkostenabrechnung für den jeweiligen Mietenden gesondert abzurechnen.
Versorgt sich der Mietende selbst mit Wärme, ermittelt die Person den CO2-Ausstoß der gemieteten Wohnung selbst.
Was müssen Vermietende im Zusammenhang mit CO2-Kosten beachten?
Vermietende sind verpflichtet, den CO2-Kostenanteil gegenüber Mietenden korrekt zu berechnen und in der jährlichen Heizkostenabrechnung auszuweisen. Dazu gehört auch die Einstufung der betreffenden Immobilie nach dem jeweiligen CO2-Ausstoß pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr.
Auf der Seite des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz finden Sie ein Online-Tool zur Berechnung der Aufteilung der Kohlendioxidkosten: bmwk.de